TOP 100 Startup Award 2015: Erster Platz mit besserem Licht
17.09.2015
L.E.S.S., der venture leaders China 2014 und Gewinner der Venture Kick Initiative befindet sich drei Jahre nach der Gründung an der Schwelle zur industriellen Produktion. Die Türen zu Millionenmärkten stehen nun weit offen. Simon Rivier und Yann Tissot wollen der Welt zeigen, was mit ihrer neuen Lichttechnologie alles möglich ist.
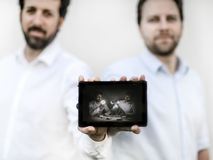 L.E.S.S. und ihre neue Lichttechnologie (Bild: Tina Sturzenegger)
|
Weniger LEDLicht in Zukunft, dafür mehr L.E.S.S.-Licht. So ungefähr lässt sich das Geschäftsziel des Startups aus Lausanne auf die kürzeste Formel bringen. Das Jungunternehmen hat mit «Light Efficient SystemS» oder eben L.E.S.S. eine völlig neue Lichttechnologie entwickelt. Diese ist den LEDLampen, die mittlerweile die herkömmlichen Glühbirnen vom Markt verdrängt haben, in mancher Hinsicht deutlich überlegen. Sollte sie sich durchsetzen, könnte es um das LED-Licht bald einmal geschehen sein. «Unser Ziel ist es, LEDs durch L.E.S.S. zu ersetzen», erklärt CEO Yann Tissot am Firmensitz, der sich im Technopark neben der EPFL in Ecublens befindet. Es mag ambitioniert klingen, doch es könnte angesichts der Nachteile von LED gelingen: Die LEDLämpchen brauchen nämlich relativ viel Platz und leuchten Flächen nicht gleichmässig aus. Und die Energieeffizienz, obwohl besser als bei Glühbirnen, lässt zu wünschen übrig: 60 Prozent des verbrauchten Stroms verwandelt sich nicht in Licht, sondern in Wärme.
Die Alternative, die L.E.S.S. nun entwickelt hat, basiert auf den Dissertationen von Tissot und Simon Rivier, Mitgründer sowie Forschungs- und Entwicklungsleiter des Startups. Der Erste hat als Doktorand in Photonik und der Zweite in nichtlinearer Optik geforscht. Aus der Verschmelzung ihrer Arbeiten ist schliesslich die neue Technologie entstanden: Lichtwellenleiter auf der Basis von nanostrukturierten Glasfasern, die vielfach stärkeres und gleichmässigeres Licht als LED erzeugen und extrem wenig Platz brauchen. Wie soll man sich das vorstellen? Tissot vergleicht die Fasern mit Neonröhren, «jedoch dünner als ein Haar, aber mit hellerem und homogenerem Licht». Ein erstes Produkt, ein ringförmiges Beleuchtungssystem von der Grösse eines Lämpchens, stellt er auf den Tisch, hält eine Münze darunter und fragt: «Schatten? Sehen Sie irgendwo einen Schatten?» In der Tat lässt sich der Zweifränkler unter dem Beleuchtungsring beliebig drehen und wenden, ohne dass er auch nur die geringste Spur eines Schattens zeigt.
Das neue Lichtwunder ist also erfunden, und es funktioniert. Nun muss es nur noch seriell produziert und erfolgreich vermarktet werden. Eine grosse Herausforderung für ein kleines Startup, das den Technologiesprung jetzt Schritt für Schritt in praktische Anwendungen und Produkte umsetzt. Tissot und Rivier haben bereits erste Abnehmer gefunden. Ihr L.E.S.S.-Licht wird in «Inspektionsleuchten » zur Qualitätskontrolle in der Feinmechanik und Elektronik eingesetzt. Das homogenere Licht macht es möglich, dass die Fehlersuche mit Mikroskop, Videokamera und Spezialsoftware noch gründlicher funktioniert. Einige Schweizer Uhrenhersteller setzen inzwischen auf die neuen Lichtfasern aus Lausanne. Ebenso nutzen sie Unternehmen in Deutschland und Japan, welche Systeme für die Qualitätskontrolle etwa in der Elektronikindustrie, der Medizintechnik und der Automobilindustrie produzieren. L.E.S.S. bedient hier als Zulieferer von Systemintegratoren zwar lediglich einen Nischenmarkt. «Dessen Volumen ist aber deutlich grösser, als wir uns das zuerst vorgestellt haben», sagt Tissot. Über ein vielversprechendes zweites Anwendungsgebiet will der Firmenchef noch nichts Genaueres verraten. Es geht dabei um einen grösseren Auftrag für einen deutschen Autohersteller. «Was ich im Moment dazu sagen kann, ist, dass unsere Lichtfasern eine wichtige Komponente des Autos revolutionieren werden», tönt es geheimnisvoll.

Simon Rivier und Yann Tissot von CEO und CTO von L.E.S.S. mit ihren Lichtquellen. (Bild: Tina Sturzenegger)
Das dritte Anwendungsgebiet,das sich für die Lichtfasern abzeichnet, ist das wohl lukrativste und vielversprechendste. Hier geht es nicht um massgeschneiderte Spezialanwendungen, sondern um einen Massenmarkt. Die Rede ist von Bildschirmen und damit von Laptops, Tablets, Smartphones usw. Klar scheint: Wenn die für die Hintergrundbeleuchtung derzeit verwendeten LEDs – pro Gerät Dutzende –durch die leuchtenden Fasern aus Lausanne ersetzt würden, würden die Bildschirme besser und – dank geringerem Stromverbrauch – länger leuchten. Darüber hinaus erlauben die winzigen Fasern den Bau von extrem flachen und rahmenlosen Bildschirmen. Es sind Vorteile, angesichts deren man sich fragt, warum die grossen Display- und Tablets-Hersteller dem Startup nicht längst schon die Türen einrennen. «Es genügt nicht, den grossen Konzernen ein paar Fasern und bestenfalls einen Prototyp zu präsentieren», gibt Tissot zu bedenken. Um mit den potenziellen Grossabnehmern überhaupt ins Geschäft zu kommen, braucht es Tausende von L.E.S.S.-Einheiten, allein schon für Testzwecke. Dafür fehlte dem Startup bisher das Geld.
Jetzt ist alles anders: Im Frühjahr 2015 konnte L.E.S.S. eine erste Finanzierungsrunde über 3 Millionen Franken – vorwiegend von namhaften Business Angels im Umfeld von venturelab – erfolgreich abschliessen. «Das Geld wird eingesetzt, um eine erste industrielle Produktion aufzubauen », verrät Tissot. Dafür gilt es weitere Entwicklungsarbeit zu leisten. Der Schritt von der handwerklichen zur automatischen Fertigung soll aber bald vollzogen sein. Läuft alles nach Plan, so wird bis Ende Jahr eine erste Produktionslinie laufen.
In einem kürzlich hinzugemieteten Raum von 250 Quadratmetern soll die Produktion schrittweise hochgefahren werden: Im nächsten Jahr auf 10 000, 2017 dann auf 100 000 und schliesslich 2018 auf mindestens eine Million Einheiten. Es wird zu einem Wettlauf mit der Zeit, «denn bereits jetzt haben wir eine grosse Nachfrage nach den Lichtfasern, können aber noch nicht liefern», so Tissot.
Luxusproblem oder Stress? «Beides», räumt der Chef ein, der als ehemaliger Spitzenschwimmer Wettläufe mit der Zeit bestens kennt. Bereits in diesem Jahr sollen Einnahmen in der Höhe von über 1 Million Franken generiert werden. Spätestens 2017 will L.E.S.S. den Break-even erreichen. Tissot und Rivier rechnen, dass sie in fünf Jahren rund 200 Personen beschäftigen und einen mittleren zweistelligen Millionenumsatz erzielen werden. Der Hauptsitz soll in Lausanne bleiben; für die Vermarktung sind Büros in Asien und den USA geplant. Das Volumen des primären Marktes, den L.E.S.S. anpeilt, beträgt derzeit über 12 Milliarden Franken.
Die Alternative, die L.E.S.S. nun entwickelt hat, basiert auf den Dissertationen von Tissot und Simon Rivier, Mitgründer sowie Forschungs- und Entwicklungsleiter des Startups. Der Erste hat als Doktorand in Photonik und der Zweite in nichtlinearer Optik geforscht. Aus der Verschmelzung ihrer Arbeiten ist schliesslich die neue Technologie entstanden: Lichtwellenleiter auf der Basis von nanostrukturierten Glasfasern, die vielfach stärkeres und gleichmässigeres Licht als LED erzeugen und extrem wenig Platz brauchen. Wie soll man sich das vorstellen? Tissot vergleicht die Fasern mit Neonröhren, «jedoch dünner als ein Haar, aber mit hellerem und homogenerem Licht». Ein erstes Produkt, ein ringförmiges Beleuchtungssystem von der Grösse eines Lämpchens, stellt er auf den Tisch, hält eine Münze darunter und fragt: «Schatten? Sehen Sie irgendwo einen Schatten?» In der Tat lässt sich der Zweifränkler unter dem Beleuchtungsring beliebig drehen und wenden, ohne dass er auch nur die geringste Spur eines Schattens zeigt.
Das neue Lichtwunder ist also erfunden, und es funktioniert. Nun muss es nur noch seriell produziert und erfolgreich vermarktet werden. Eine grosse Herausforderung für ein kleines Startup, das den Technologiesprung jetzt Schritt für Schritt in praktische Anwendungen und Produkte umsetzt. Tissot und Rivier haben bereits erste Abnehmer gefunden. Ihr L.E.S.S.-Licht wird in «Inspektionsleuchten » zur Qualitätskontrolle in der Feinmechanik und Elektronik eingesetzt. Das homogenere Licht macht es möglich, dass die Fehlersuche mit Mikroskop, Videokamera und Spezialsoftware noch gründlicher funktioniert. Einige Schweizer Uhrenhersteller setzen inzwischen auf die neuen Lichtfasern aus Lausanne. Ebenso nutzen sie Unternehmen in Deutschland und Japan, welche Systeme für die Qualitätskontrolle etwa in der Elektronikindustrie, der Medizintechnik und der Automobilindustrie produzieren. L.E.S.S. bedient hier als Zulieferer von Systemintegratoren zwar lediglich einen Nischenmarkt. «Dessen Volumen ist aber deutlich grösser, als wir uns das zuerst vorgestellt haben», sagt Tissot. Über ein vielversprechendes zweites Anwendungsgebiet will der Firmenchef noch nichts Genaueres verraten. Es geht dabei um einen grösseren Auftrag für einen deutschen Autohersteller. «Was ich im Moment dazu sagen kann, ist, dass unsere Lichtfasern eine wichtige Komponente des Autos revolutionieren werden», tönt es geheimnisvoll.

Simon Rivier und Yann Tissot von CEO und CTO von L.E.S.S. mit ihren Lichtquellen. (Bild: Tina Sturzenegger)
Das dritte Anwendungsgebiet,das sich für die Lichtfasern abzeichnet, ist das wohl lukrativste und vielversprechendste. Hier geht es nicht um massgeschneiderte Spezialanwendungen, sondern um einen Massenmarkt. Die Rede ist von Bildschirmen und damit von Laptops, Tablets, Smartphones usw. Klar scheint: Wenn die für die Hintergrundbeleuchtung derzeit verwendeten LEDs – pro Gerät Dutzende –durch die leuchtenden Fasern aus Lausanne ersetzt würden, würden die Bildschirme besser und – dank geringerem Stromverbrauch – länger leuchten. Darüber hinaus erlauben die winzigen Fasern den Bau von extrem flachen und rahmenlosen Bildschirmen. Es sind Vorteile, angesichts deren man sich fragt, warum die grossen Display- und Tablets-Hersteller dem Startup nicht längst schon die Türen einrennen. «Es genügt nicht, den grossen Konzernen ein paar Fasern und bestenfalls einen Prototyp zu präsentieren», gibt Tissot zu bedenken. Um mit den potenziellen Grossabnehmern überhaupt ins Geschäft zu kommen, braucht es Tausende von L.E.S.S.-Einheiten, allein schon für Testzwecke. Dafür fehlte dem Startup bisher das Geld.
Jetzt ist alles anders: Im Frühjahr 2015 konnte L.E.S.S. eine erste Finanzierungsrunde über 3 Millionen Franken – vorwiegend von namhaften Business Angels im Umfeld von venturelab – erfolgreich abschliessen. «Das Geld wird eingesetzt, um eine erste industrielle Produktion aufzubauen », verrät Tissot. Dafür gilt es weitere Entwicklungsarbeit zu leisten. Der Schritt von der handwerklichen zur automatischen Fertigung soll aber bald vollzogen sein. Läuft alles nach Plan, so wird bis Ende Jahr eine erste Produktionslinie laufen.
In einem kürzlich hinzugemieteten Raum von 250 Quadratmetern soll die Produktion schrittweise hochgefahren werden: Im nächsten Jahr auf 10 000, 2017 dann auf 100 000 und schliesslich 2018 auf mindestens eine Million Einheiten. Es wird zu einem Wettlauf mit der Zeit, «denn bereits jetzt haben wir eine grosse Nachfrage nach den Lichtfasern, können aber noch nicht liefern», so Tissot.
Luxusproblem oder Stress? «Beides», räumt der Chef ein, der als ehemaliger Spitzenschwimmer Wettläufe mit der Zeit bestens kennt. Bereits in diesem Jahr sollen Einnahmen in der Höhe von über 1 Million Franken generiert werden. Spätestens 2017 will L.E.S.S. den Break-even erreichen. Tissot und Rivier rechnen, dass sie in fünf Jahren rund 200 Personen beschäftigen und einen mittleren zweistelligen Millionenumsatz erzielen werden. Der Hauptsitz soll in Lausanne bleiben; für die Vermarktung sind Büros in Asien und den USA geplant. Das Volumen des primären Marktes, den L.E.S.S. anpeilt, beträgt derzeit über 12 Milliarden Franken.
TEXT: PIRMIN SCHILLIGER


